© Pixabay
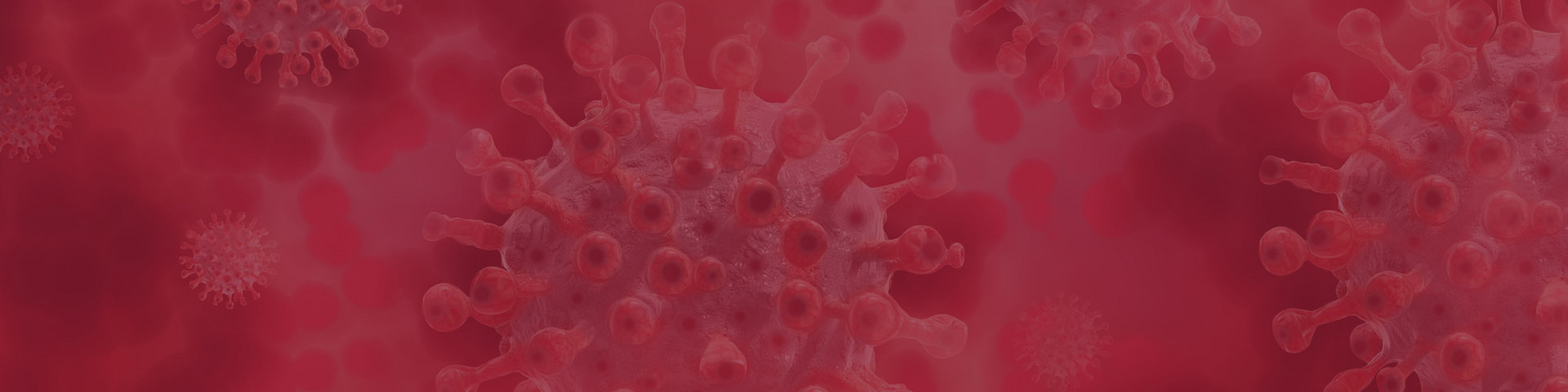
Coronavirus in Rheinland-Pfalz
Noch immer infizieren sich in Rheinland-Pfalz jeden Tag Hunderte mit dem Coronavirus. Bund und Länder haben daher umfassende Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Seit dem 1. Oktober 2022 und bis zum 7. April 2023 gilt ein bestimmter Rechtsrahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen. Ziel ist vor allem der Schutz vulnerabler Gruppen. Auf dieser Seite finden Sie alle wichtige Fragen und Antworten sowie Informationen zu Schnelltests und der Impfung.
Aktuelle Fallzahlen
Informationen zu Corona-Schnelltests in Rheinland-Pfalz
Mit der Änderung der Testverordnung des Bundes, welche am 30. Juni 2022 in Kraft getreten ist, sind kostenlose Corona-Bürgertests nur noch für bestimmte Personengruppen vorgesehen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Symptome einer Corona-Infektion haben, wenden Sie sich für eine PCR-Testmöglichkeit bitte telefonisch an Ihre Hausarztpraxis oder die Telefonnummer 116117.
Informationen zur Corona-Impfung in Rheinland-Pfalz
Impfungen sind und bleiben das effektivste Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Alle Informationen, die Sie für Ihren Impftermin benötigen, können Sie hier nachlesen: https://impfen.rlp.de/de/informationen/
Des Weiteren finden Sie hier Wissenswertes zu Impfnachweisen und den verschiedenen Impf- bzw. Genesenenstatus sowie zu Auffrischimpfungen und den verschiedenen Impfstoffen.
